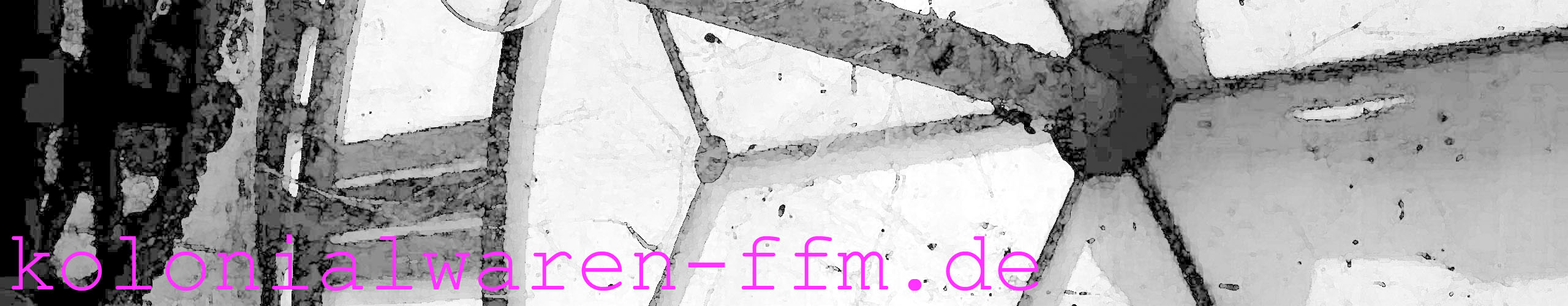Als mein Vater mich Mariam nannte, konnte er nicht ahnen, dass seine Religion einmal so in Verruf geraten würde: Die islamische Kultur genoss in der Kolonialzeit hohes Ansehen. Mozart etwa schrieb eine Musik zur Entführung aus dem Serail, Rückert fertigte die erste Übersetzung des Korans ins Deutsche an, Goethe wob islamische Dichtkunst in seinen West-Östlichen Divan mit hinein, Hitler verbündete sich mit Muslimen. Wenn die Eltern zusammengeblieben wären, wären wir, ich und meine beiden Schwestern, vielleicht Musliminnen geworden, vielleicht sogar deutsche Musliminnen. So allerdings wurde ich eine christlich-deutsche Mariam, und teilte bis vor einigen Jahren die Vorurteile meiner Umgebung über den Islam. Es kam vor, dass ich mich für meinen Namen schämte. Mariam ist ein ebenso typisch muslimischer Name, wie Maria ein typisch christlicher Name ist. Sogar eine Koransure heißt Mariam.
Erst spät las ich nach: Mirjam, Maria, Mariam, alles Namen aus der abrahamitischen Religionsfamilie. Im Judentum gibt es die Prophetin Mirjam, im Christentum heißt die Mutter des Gottessohnes Maria, im Islam ist Mariam die Mutter des Propheten Isa. Heute berufen sich die Kirchen gern auf ihr jüdisch-christliches Erbe und verschweigen dabei den Islam als das jüngste Geschwister der Religionsfamilie. Die Familienähnlichkeit ist trotzdem nicht zu übersehen für den, der sich die Mühe macht genauer hinzusehen.
Als eine christlich-deutsche Mariam hielt ich mich lange für eine reguläre Deutsche und wurde im Großen und Ganzen auch so behandelt: Offene Fremdenfeindlichkeit war lange verpönt. Aber nach meinem Hochschulabschluss schien mir, dass für mich immer mehr Türen zugingen, wenn zu meinem europäischen Familiennamen mein Vorname dazukam, etwa bei schriftlichen Bewerbungen, besonders bei qualifizierteren Jobs oder begehrteren Wohnungen.
Im Lauf der Jahre musste ich mir zudem immer abstrusere Geschichten anhören: Bei Euch sei es doch so und so, ob ich in meine Heimat führe, ob ich Indisch spräche, ob meine Deutschkenntnisse ausreichten: Typischerweise eine Frage von Deutschen, denen es daran fehlte, und ein wachsendes Problem während meiner letzten Berufsjahre in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich musste mich einmal sogar darüber belehren lassen, dass mein Name aber doch so und so zu schreiben sei: Die altbekannte Überlegenheitsillusion, die politisch auch gefördert wurde und wird. Durch Auslassungen, durch Andeutungen, durch Amtshandlungen.
Mag sein, dass jüngere Mariams sich von der augenblicklich verfinsterten Situation in Deutschland entmutigen lassen. Das sollten sie nicht, denn Deutschland, unser aller Heimat, ist ein schönes Land, und Mariams werden hier dringend gebraucht, beispielsweise als ErzieherInnen und LehrerInnen: Ein Drittel aller Kinder im Kindergartenalter haben einen Migrationshintergrund. Wir müssen unser Teil dazu beitragen, dass dieses Land seine kulturelle und ethnische Vielfalt schätzen und bewahren lernt, sonst haben die NPDs, AfDs und Pegidas, die eigentlich eine kleine Minderheit sind, gewonnen. Dazu gehört, sich zu Ausgrenzungserfahrungen zu äußern, wie das gegenwärtig mit der #MeTwo-Bewegung geschieht.
Update 18.11.2018:
Anette Kahane (Amadeu Antonio Stiftung) zum #MeTwo-Hashtag: Rassismus ist das Problem, nicht die zwei Seelen in einer Brust. Rechte Parteien propagieren derzeit das heile Dorfleben um 1900. Aber die Ausgrenzung von Teilen der deutschen Bevölkerung ist nicht zukunftsfähig: Wie wir wissen. Rückwärtsgewandte Renationalisierung auch nicht, jedenfalls nicht in einer Welt sich verdichtender Machtblöcke. Auch wenn alte weiße Männer und deren weibliche Marionetten damit großspurig daherkommen und dafür medial gefeiert werden.